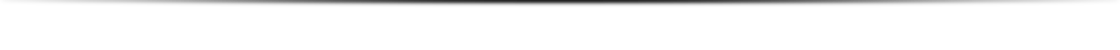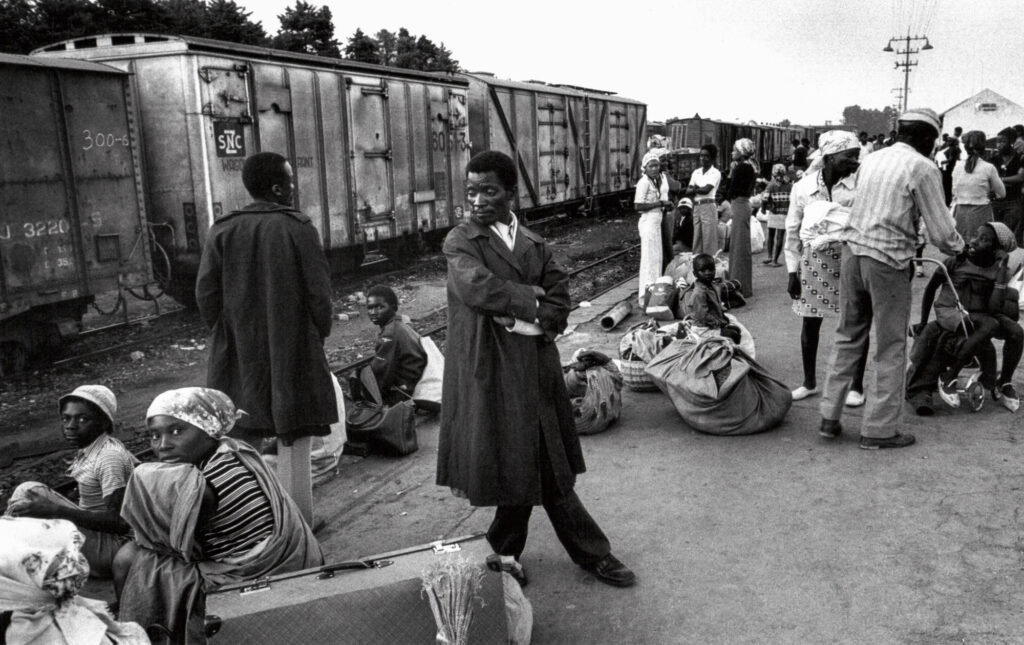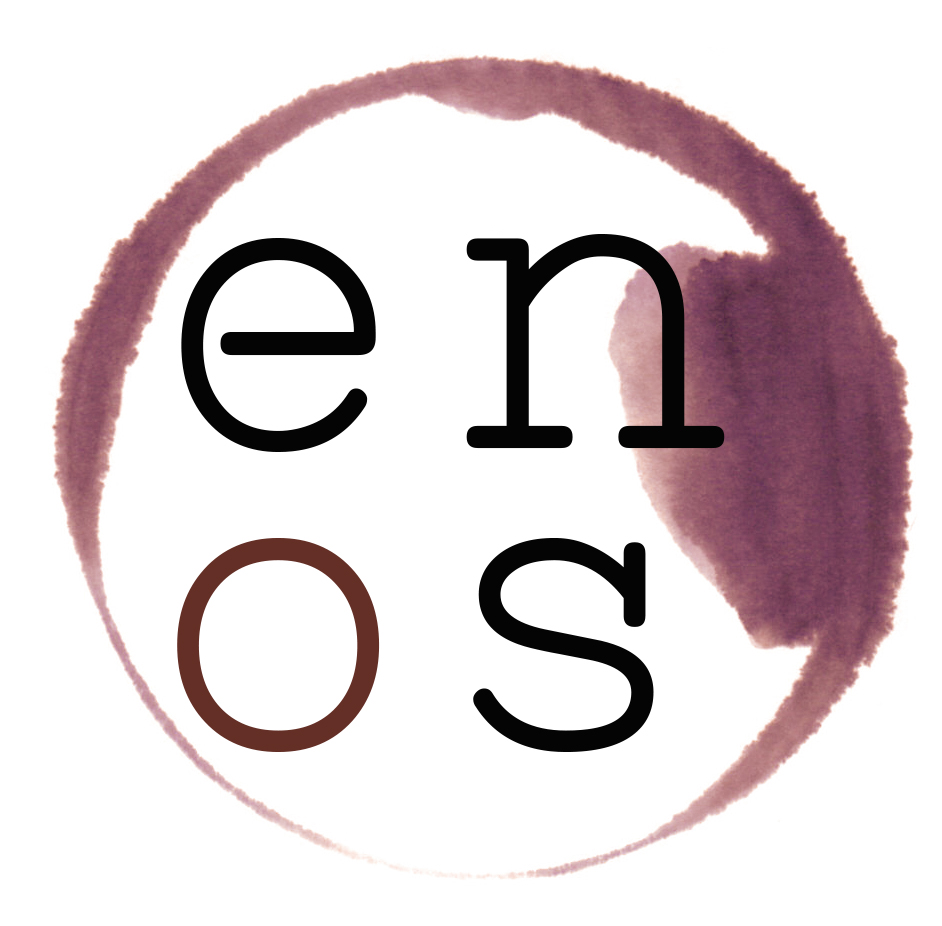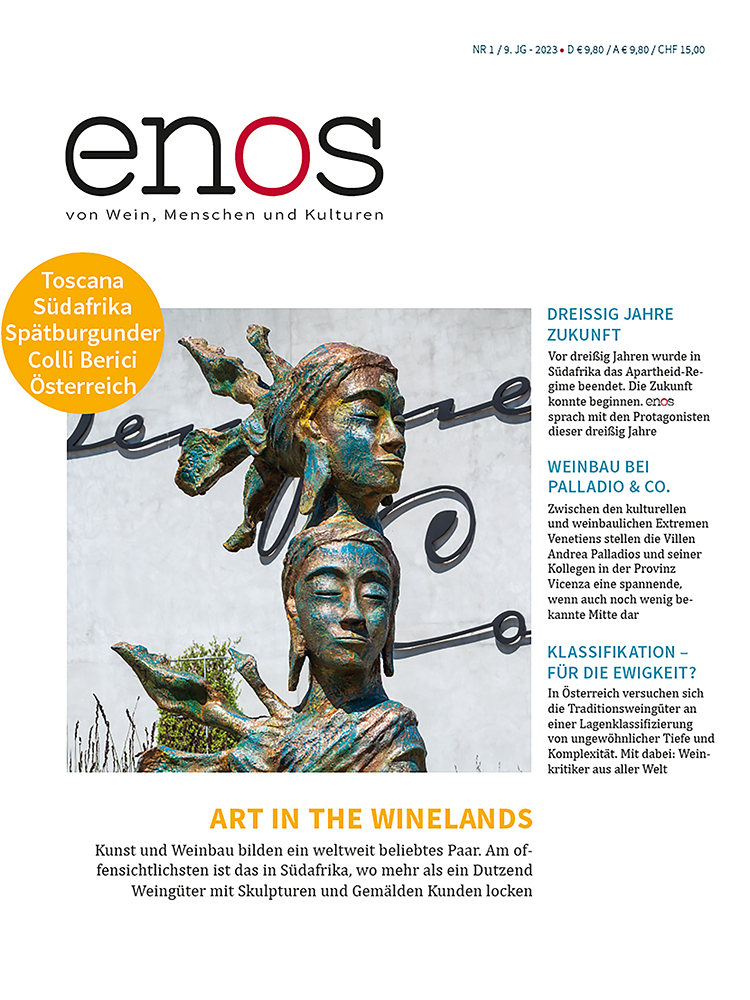Liebe Leserinnen und Leser
Wer sich heute noch mit Ethnologie, der Wissenschaft von fremden, traditionellen und nicht-westlich geprägten Gesellschaften beschäftigt, muss sich fragen lassen, ob diese Wissenschaft überhaupt noch einen Gegenstand, ein Tätigkeits- und Wirkungsfeld hat. Zu sehr scheinen inzwischen auch die letzten, wenigstens noch teilweise traditonellen außereuropäischen Zivilisationen vom Kontakt mit der westlichen geprägten Lebensweise dominiert, wenn sich nicht gleich gänzlich verschwanden, vernichtet wurden. Zu sehr haben sich auch noch existierende Sozialstrukturen, Glaubenssysteme, Riten und Geplogenheiten in den letzten ein, zwei Dutzend Jahrzehnten unter dem Einfluss des Weltmarkts verändert.
Und doch hat sich gerade in dieser scheinbaren ethnologischen Götterdämmerung gleich eine ganze Reihe neuer wissenschaftlicher Ansätze aufgetan, von der postmodernen über die reflexive Anthropologie, die Praxistheorie, die post-koloniale oder gar post-humane Ethnologie bis hin zu Geerts‘ „writing culture“. Es sind Ansätze, auf die ich in einem vorhergehenden Essay kurz eingegangen bin, die allerdings m. E. wenig bis keine wirklichen Antworten auf die grundlegenden erkenntnistheoretischen Fragestellungen boten und bieten. Einer der jüngsten und auffälligsten Versuche der vor allem angelsächsischen akademischen Welt, der „Wissenschaft vom kulturell Fremden“ neues Leben einzuhauchen, hat sich jetzt darangemacht, die vor einem guten Jahrhundert in der deutschsprachigen Philosophie entstandene philosophische Schule der Phänomenologie bzw. phänomenologischen Methode für die ethnologische Forschung nutzbar zu machen.
Der Ansatz, obwohl ich ihm schon von Anbeginn allein aus philosophischen Überlegungen und einer länger zurückliegenden Rezeption von Schriften Theodor W. Adornos kritisch gegenüberstand, hat mich dennoch zu längerem Lesen und schließlich, einige Zeit nach Veröffentlichung meines erwähnten Essay zum vorliegenden Text motiviert, wozu auch die Tatsache beitrug, dass der ursprünglich in der angelsächsischen Wissenschaftswelt entstandene phänomenologische Ansatz inzwischen auch in der deutschsprachigen ethnologischen Wissenschaft Gefallen gefunden hat. Die Phänomenologie – diese Warnung gleich vorneweg – ist allerdings keine leichtverdauliche Disziplin, und das gilt auch für die Versuche ihrer ethnogischen Nutzbarmachung. Vor allem aber ist sie so vielschichtig und komplex, dass eine wirklich umfassende und erschöpfende Auseinandersetzung mit ihr im Zusammenhang einer ethnologischen Theoriediskussion kaum zu leisten ist. Der Text versucht dennoch, zumindest ansatzweise eine Idee von den Antinomien der phänomenologischen Philosophie zu geben, um anschließend die Versuche einer phänomenologishen Ethnologie zu diskutieren.
Ihnen, liebe Leser, an dieser Stelle Spaß bei der Lektüre zu wünschen, könnte der eine oder andere angesichts der nicht einfachen Aufgabe als zynisch missverstehen; deshalb lasse ich es, hoffe aber dennoch, dass die, die mit mir auf die beschwerliche gedankliche Reise gehen, dies am Ende mit Gewinn getan haben werden.
Ihr
Eckhard Supp
enos Wein
Begrabt mein Herz an der Biegung … der Mosel!
von Eckhard Supp letzte korrigierte Fassung vom 24.7.24, 14:48 Uhr Unfälle, Naturkatastrophen, Kriege … Die Liste der Assoziationen, die sich wohl jedem bei Nennung des „Roten Kreuzes“ einstellen, ist lang – Wein dürfte mit einiger Sicherheit nicht dazu gehören. Und doch betreibt das Deutsche Rote Kreuz mit seinem „Sozialwerk Bernkastel-Wittlich“ an der Mosel sein weltweit […]
Die Band vom See
von Eckhard Supp Gelegentlich nennen sie sich „aboriginal people“, auch wenn wahrscheinlich die meisten Menschen diese Bezeichnung eher mit den Ureinwohnern Australiens assoziieren würden. Ansonsten sind sie „Osoyoos“, eine „native band“, eine „first nation“ oder ein „tribe“, wie man in Kanada respektive den USA eingeborene Gesellschaften nennt. Sie leben seit Urzeiten an den Ufern des […]
Trinken (bis) weil der Arzt kommt
Nach heutigen Maßstäben scheint es unvorstellbar, und wirklich gesichert ist die Zahl wohl auch nicht: Im berühmten Hötel-Dieu von Beaune, Teil des historischen Hospitals „Hospices Civils de Beaune” der Weinhauptstadt des Burgund, sollen die Alten und Kranken, die hier zur Zeitenwende zwischen Mittelalter und Neuzeit gepflegt wurden, für den persönlichen Konsum ein Recht auf sage […]
enos Kultur
Falsch abgebogen – Viel Positives fürs Negative
Eine Rezension von Eckhard Supp letzte korrigierte Fassung vom 21.12.25 Der Name Karl Heinz Haag (1924-2011) dürfte selbst unter Adepten der deutschen Philosophie des 20. Jahrhunderts keiner sein, mit dem man spontan sehr viel verbinden kann. Das mag zumindest teilweise daran liegen, dass der im Frankfurter Stadteil Höchst geborene Haag, ein Vertreter der zweiten Generation […]
Fotos betrachten – aber doch nicht so!
Eine Rezension von Eckhard Supp letzte korrigierte Fassung vom 25.10.25 (Links zu den im Text erwähnten Fotos, s. Anhang) Eigentlich klang der Titel interessant, und die beim raschen Durchblättern von „Fotografie betrachten“ entdeckten Abbildungen verstärkten den positiven Eindruck. Dabei kommt der französische Autor, Laurent Jullier, gar nicht aus der Welt der Fotografie, sondern aus der […]
Entschlossene Unentschlossenheit
Eine Rezension von Eckhard Supp letzte korrigierte Fassung vom 3.8.25 Auf Clifford Geertz (1926-2006), der weithin als einer der bedeutendsten Ethnologen des ausgehenden 20. Jahrhunderts gerühmt wird, bin ich in meiner eigenen Arbeit leider erst sehr spät gestoßen. Und das, obwohl Geertz sein „Hauptwerk“, wenn man so will, bereits etwa ein Jahrzehnt vor dem Erscheinen meiner […]