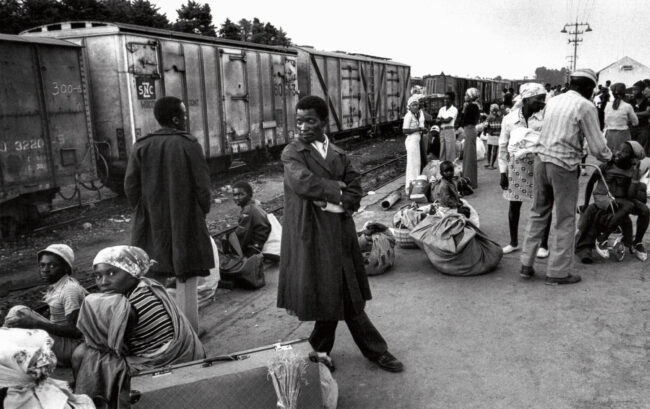Eine Rezension von Eckhard Supp
letzte korrigierte Fassung vom 3.8.25
Auf Clifford Geertz (1926-2006), der weithin als einer der bedeutendsten Ethnologen des ausgehenden 20. Jahrhunderts gerühmt wird, bin ich in meiner eigenen Arbeit leider erst sehr spät gestoßen. Und das, obwohl Geertz sein „Hauptwerk“, wenn man so will, bereits etwa ein Jahrzehnt vor dem Erscheinen meiner Arbeit über Australiens Aborigines[1] veröffentlicht hatte. Dabei darf man sich unter der Bezeichnung „Hauptwerk“ keine dicke Monographie oder gar ein vielbändiges ethnologisches Standardwerk vorstellen: Es handelt sich um eine Sammlung kürzerer und längerer Essays unter dem Titel „The interpretation of Cultures“[2], die erstmals 1973, in einer deutschen Übersetzung sogar erst 2002 erschien[3].
Dass ich erst Ende letzten Jahres, nach Abschluss meiner eigenen Arbeit über erkenntnistheoretische Probleme in der Ethnologie[4] und im Zuge meiner Beschäftigung mit phänomenologischen Tendenzen in der aktuellen ethnologischen Theoriebildung[5] Gelegenheit hatte, mich mit der „Interpretation von Kulturen“ – so hätte ich die deutsche Ausgabe eher betitelt[6], denn das Interpretieren spielt in Geertz‘ „interpretativer Anthropologie ja eine erste Geige – zu beschäftigen. Das mag u. a. daran gelegen haben, dass auch englisch- wie deutschsprachige Veröffentlichungen über Geertz erst von den Nullerjahren an zu haben waren, glaubt man den entsprechenden Literaturlisten auf Wikipedia, und dass mein eigener Fokus eher bei Autoren wie Marshal Sahlins (1930-2021), Robert Tonkinson (1938-2024) oder – als intellektuelle Herausforderung – Claude Lévi-Strauss (1908-2009) lag.
Umso positiver war ich dann jetzt überrascht, zu entdecken, dass offenbar schon vor 40, 50 Jahren Themen „in der Luft“ gelegen hatten, mit denen sich Geertz lange Zeit beschäftigte und an denen ich selbst seinerzeit wie auch heute knabberte und noch knabbere, ohne auf alle meine Fragen schlüssige Antworten gefunden zu haben.
Eine der jüngeren Erscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt, die sich mit dem Werk Clifford Geertz‘ beschäftigt, ist der 2020 von dem österreichischen Theologen Franz Gmainer-Pranzl zusammen mit der deutschen Kulturphilosophin Barbara Schellhammer im Schweizer Verlag Peter Lang herausgegebene Sammelband „Culture – A Life of Learning“[7].
Wenn ein Theologe als Herausgeber tätig wird, darf man sich wahrscheinlich nicht wundern, wenn unter den Autoren bemerkenswert viele – vier von 15 – Theologen fungieren, obwohl mir die „Kombi Geertz-Theologie“ bei meiner eigenen Lektüre von „Interpretation of Cultures“ als letzte in den Sinn gekommen wäre, und das trotz des in der Sammllung enthaltenen Essays unter der Überschrift „Religion As a Cultural System“[8]. Man mag das ebenso als lässliche Besonderheit betrachten, wie auch die mehrfache Hinführung zum Werk Geertz‘ über „Populismus, Nationalismus, Radikalismus, Extremismus, Fundamentalismus“ der „heutigen Zeit“[9], die ja nicht so wirklich auf die erkentnistheoretischen Aspekte des einen oder anderen Essays passen wollen und wohl eher der Tagesaktualität zum Zeitpunkt der Veranstaltung einer Tagung der Münchener Jesuiten-Hochschule für Philosophie, für die die Beiträge geschrieben wurden, geschuldet sind.
Immerhin aber muss ich feststellten, dass eine der interessantesten Erzählungen des Bandes von einem Theologen (und Tauchschulbesitzer), Jörg Scharf, stammt, der aus seiner Arbeit auf Bali von Erfahrungen berichtet[10], wie ich sie selbst anlässlich (und nach) meiner Arbeit in und nach Australien machen konnte. Scharf benennt darin idealistische Vorurteile und Naturidolatrien, welche deutsche Touristen in ihrer Haltung zur balinesischen Bevölkerung – Scharf zitiert in diesem Zusammenhang Rousseaus „edle Wilde“ – regelmäßig an den Tag legen[11]. Wer solche Idealisierung des „Fremden“ kritisiert, so meine persönliche Erfahrung nach der Veröffentlichung meiner Arbeit über die Aborigines, musste damals bestenfalls mit Unverständnis, eher aber mit Wutausbrüchen und Drohungen gutmeinender „Dritt-Welt-Aktivisten“ rechnen: Offenbar hat sich diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten nicht allzu viel geändert.
Ein wenig wie spätromantische Träumerei kam mir auch der Essay „Bäuerliche Kultur als Bedeutungsgewebe“[12] der Germanistin und Historikerin Gudrun Schweisfurth in ihrem Versuch vor, bäuerliche Kultur in Deutschland zu verstehen. Was die Autorin dort unter Berufung auf den Geertzschen Kulturbegriff („selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe“) als Frage aufwirft, nämlich „wie die Menschen sich selbst verstehen“[13], hinterließ bei mir den Eindruck, dass sie die Geertzsche (ursprünglich vom britischen Philosophen Gilbert Ryle [1900-1976] stammende) „dichte Beschreibung“[14] mit romantisierender Teilhabe verwechselt. Das Ganze gerinnt ihr dann besonders dort, wo sie sich etwa auf einen Interviewpartner, seines Zeichens Biobauer und ehemaliger Bundestagsabgeordneter stützt, der vom „Früher war alles besser“[15] träumt, zu einer eher „dünnen“ Idealisierung der Vergangenheit. Die im Übrigen doch recht massiv der Geertzschen Ablehnung jeglicher Manichäismen widerspricht, die der amerikanische Kulturpsychologe Richard Allan Shweder in seinem Beitrag[16] expliziert.
Weshalb Schweisfurth die „dichte Beschreibung“ als eine Methode sieht, die keine Methode sein möchte“[17], hätte zumindest einer deutlicheren Erklärung bedurft. Ich erinnere mich eher daran, dass Geertz die Naturwissenschaften und ihre formalen Methoden[18] zurückwies, nicht (ethnographische) Methoden generell. Welchen Sinn hätte sonst ein Programm, wie das der „dichten Beschreibung“ („thick description“) und seine Abgrenzung von der „dünnen Beschreibung, dem oberflächlichen gehabt?
Ein Fragezeichen gehört auch vor die Behauptung, Geertz‘ „dichte Beschreibung“ erfordere nicht nur genaues Beobachten und Dabeisein, sondern aktives „Mittun“, welches allein wichtige Erfahrungen und „Emotionen“ ermögliche.[19] Anstatt nur Fakten „im Detail“ zusammenzutragen, sucht die Geertzsche „dichte Beschreibung“ laut Schweisfurth nach einem (notwendig abstrakten?) Wesen[20] und nach der Bedeutung (Bedeutung für uns?) der Dinge und Handlungen[21]. Ob das wirkllich die „interpretative“ Seite der Anthropologie darstellt[22] oder eher der Suchte nach einer abstrakt-theoretischen „Schublade“ entspricht, in die Geertz zu stecken ist, bliebe auszudiskutieren. Das Beispiel der beiden nervös blinzelnden bzw. bedeutungsvoll zwinkernden Jungen[23], das Geertz (von Ryle übernommen) exemplarisch anführt, zeigt m E., dass der Unterschied in einer unterschiedlichen, sehr konkreten Ursache bzw. Intention liegt.[24]
Wobei auch ungeklärt bleibt, ob und unter welchen Voraussetzung unsere Erkenntnisfähigkeiten überhaupt bis zu solch abstraktem Wesen und solcher Bedeutung reichen können, was aber vielleicht für Theologen keine ernstzunehmende Frage darstellt. Ja, Empathie ist gut, auch in der (Gesellschafts-)Wissenschaft, aber sie sollte die wissenschaftliche Arbeit, für Geertz das genaue Erfassung möglichst vieler mikroskopischer Details[25] als Basis von Analyse und Interpretation[26], nicht zu ersetzen versuchen. Noch wichtiger: Anstatt romantischem „Mittun“ das Wort zu reden, vergisst Geertz nie, die Distanz zu seinem „fremden“ Gegenüber. Er betont. „… anthropological writings are themselves interpretations, and second and third order ones to boot. (By definition, only a ‚native‘ makes first order ones …)”[27].
Aber fangen wir von vorne an. Die Einführung (der Herausgeber?) ist leider knapp gehalten. Zu knapp, wenn man die Vielfalt der sich teilweise widersprechenden Ansätze der einzelnen Essays vor Augen hat, denen eine wissenschaftliche Einordnung gut getan hätte. Und sie enthält die eine oder andere diskussionswürdige Aussage, wie die, „Geertz … (gehe) es … um phänomenologische Beschreibungen einschlägiger Beobachtungen, die er akribisch vornimmt, um dann nach Sinn und Bedeutung seiner Beobachtungen zu fragen.“ Was mag mit dieser „phänomenologischen Beschreibung“ von „Beobachtungen“ gemeint sein? Das akribische Beschreiben von Phänomenen? Dann hätte man das wohl auch so schreiben können. Oder eine Ethnographie im Sinne der Phänomenologie, mit der ich mich an anderer Stelle auseinander gesetzt habe?[28]
Auch von einem „hermeneutisch-phänomenologischen Programm(..)“[29] ist noch die Rede, aber darauf werde ich später noch eingehen. Es folgt einer der längsten und interessantesten Beiträge des Bandes: der bereits erwähnte Essay von Richard Shweder mit dem Titel „Die entschlossene Unentschlossenheit des Clifford Geertz“. Die gelungene biographische Darstellung hat meine Skepsis gegenüber Versuchen gestärkt, Geertz mehr oder weniger umstandslos in eine der erwähnten „Schubladen“ zu stecken, sprich, irgendeiner akademischen „Schule“ zuzuschlagen – der der Phänomenologie, von der ich berichtete[30], oder denen von Neopositivismus, Postmodernismus und moralischem Aktivismus, von denen Shweder[31] schreibt. Was Geertz sucht, so Shweders Fazit, ist „… etwas anderes, etwas entschieden Unentschiedenes“[32], um zu ergänzen: „Es scheint mir eine rechtmäßige Feststellung zu sein, dass Geertz sich nie in einem dieser intellektuellen Lager zuhause fühlte und sie nur selten besuchte.“[33] „… er schrieb sehr bewusst als ein nervöser, entschlossen unentschlossener Beobachter, der nie das Bedürfnis hatte, sich auf die eine oder andere Seite irgendeiner Spaltung in den Sozialwissenschaften zu schlagen.“[34]
Dass Shweder Geertz gegen den Vorwurf verteidigt, ein Skeptiker oder Relativist gewesen zu sein[35], muss man wohl auf dem Hintergrund der Wissenschaftsdebatten der Zeit verstehen. Dass im Gegenteil Wissenschaft ohne Skepsis nicht möglich, ein eurozentrismuskritischer Relativismus der Ethnologie sehr gut steht oder stünde, habe ich wiederholt darzustellen versucht[36], und das halte ich auch nach der Lektüre von „Interpreting cultures“ für angebracht, selbst wenn Geertz die Eurozentrismus-Debatte wegen ihrer Nutzung als moralische Keule gelegentlich ins Abseits zu stellen scheint.[37]
Der deutsche Theologe und Philosoph Johannes Müller beschäftigt sich in seinem kurzen Essay „Zum Kulturbegriff von Clifford Geertz“ mit erkenntnistheoretischen Aspekten der Geertzschen „dichten Beschreibung“. Auffällig ist dabei seine Unterscheidung zwischen Kultur und Natur, die er so fasst: „Im Unterschied zur physisch-biologischen Natur als seinem primären Lebensraum ist die vom Menschen selbst geschaffene Kultur sein sekundärer Lebensraum, der in gewisser Weise einen Ersatz für die Reduziertheit menschlicher Instinkte darstellt.“[38] Die Erklärung, warum die Natur in theoretischer Hierarchie als primär, die Kultur als sekundär eingestuft werden, liefert Müller allerdings nicht. Oder ist diese hierarchische Einstufung etwa rein zufällig erfolgt?
Insgesamt gesehen hätte diese Darstellung, wie der gesamte Beitrag Müllers, darunter auch Überlegungen darüber, was wir von Geertz lernen können – den „Blick von unten“, die „Perspektive (des) Eingeborenen“[39], den „Wunsch, den menschlichen Diskurs zu erweitern“[40] – von einer stärkeren Berücksichtigung der Ethno- bzw. Eurozentrismus-Debatte profitiert, denn ob wir wirklich in der Lage sind, die Perspektive anderer Schichten und Kulturen einzunehmen, ist zumindest diskussionswürdig, wenn nicht gar letztlich und schlussendlich ein illusionärer frommer Wunsch.
Dass Erkenntnisprozesse im Kontakt mit „Fremden“ schwierig sind, scheint auch die Position zweier weiterer Essays der Sammlung aus der Feder Gernot Saalmanns und Helmut Danners zu sein. Der deutsche Soziologe und Ethnologe Saalmann weist darauf hin, wie schwierig es schon alleine ist, „fremde“ Muttersprachler aus verwandten Kulturen zu verstehen, genauer, adäquat zu übersetzen, und spricht im Fall der Rezeption Geertzscher Texte von einer „Fehlrezeption“[41], die er auch der Mitherausgeberin des Bandes anlastet.[42] Ich frage mich da: Wenn solche Fehlrezeptionen schon innerhalb identischer oder verwandter Kulturen auftreten, wie groß müssen diese Art Schwierigkeiten dann erst in der Konfrontation so unterschiedlicher wie etwa der europäischen und afrikanischen oder auch der australischen sein – mein Thema[43] aus den 1980er Jahren? Ansonsten ist der Essay Saalmanns eine lesenswerte Darstellung des Geertzschen erkenntnistheoretischen „Dreiecks“ aus dünner“ bzw. „dichter“ Beschreibung und „Interpretation“ oder „Diagnose“.[44]
Auch der deutsche Pädagoge und Philosoph Danner stellt in seinem Essay „Hilft die ‚dichte Beschreibung‘, fremde Kulturen zu verstehen?“, einem der erkenntnistheoretische ergiebigsten der Sammlung, die Frage, ob wir bzw. die Ethnologie, fremde Kulturen überhaupt (adäquat) verstehen können[45], eine Frage, die auch im Zentrum meines Essays „Fremder, quo vadis“ stand, und die er letztlich negativ beantwortet, dabei den Weg einer Diskussion über die „interkulturelle Hermeneutik“[46] wählt. Sein Fazit: Begegnungen mit dem kulturell Fremden „… mögen in ethnologischen Befunden aufbereitet sein, wie sie beispielsweise Geertz als „dichte Beschreibung“ vorlegt. Das Problem, ihren Sinngehalt zu verstehen, bleibt.“[47]
Anders als etwa die Herausgeber[48], die bereits zitierten Müller[49] und Saalmann[50] oder auch der Ethnologe Volker Gottowik[51] und der Medienwissenschaftler Lutz Ellrich[52], geht Danner nicht einfach von einem hermeneutischen Ansatz Geertz‘ aus, sondern diskutiert die Frage des Verhältnisses von Hermeneutik und dichter Beschreibung ausführlich, ausgehend von der Frage „… ist die „interpretierende“ Wissenschaft, die Geertz meint, wirklich eine hermeneutische Wissenschaft?“[53] Oder anders gefragt: „Wie müsste eine Hermeneutik, die das Verstehen in einer interkulturellen Begegnung thematisiert, mit anderen Worten, wie müsste eine „interkulturelle Hermeneutik“ bestimmt werden?“[54]
„Natürlich“, so Danner, „geht es bei der dichten Beschreibung um Verstehen! Doch es mag sich lohnen, genauer nachzufragen, wie wir Kultur und kulturell Fremdes verstehen können; was Verstehen heißen soll, insbesondere wenn wir ausdrücklich von hermeneutischem Verstehen sprechen; wie Geertz die dichte Beschreibung bestimmt und wie diese sich möglicherweise von hermeneutischem Verstehen unterscheidet. Vielleicht geht es Geertz gar nicht um Verstehen in diesem Sinne?“[55] Es sind Fragen, die sich für Danner einem einfachen Ja-Nein entziehen. „Nun ist ein Vergleich zwischen einem hermeneutischen Ansatz und dem Vorgehen von Geertz in doppelter Weise einer begrifflichen Schwierigkeit ausgesetzt. Denn Begriffe wie Verstehen, Sinn, Bedeutung oder Symbol sind weder eindeutig, noch sind ihre jeweiligen Verwendungen problemlos gleichzusetzen. Hinzu kommt bei den Texten von Geertz das Problem der Übersetzbarkeit.“[56]
Um die Frage dennoch zu beantworten, konfrontiert Danner „… Verstehen im Sinne einer interkulturellen Hermeneutik mit der dichten Beschreibung …“[57] und stellt fest, dass „Hermeneutisches Verstehen … auf Sinn aus (ist); es ist Sinn-Verstehen; bei der Text-Interpretation handelt es sich darum, das im Text Gesagte, das vom Autor Gemeinte, den Sinn des Textes zu erfassen.“[58] Bei der dichten Beschreibung hingegen spricht Geertz, folgt man Danner, „von Symbolen und deren Bedeutung; er ist darauf aus, das kulturelle Bedeutungsgeflecht zu eruieren. Es ist wohl angemessen, von ‚Bedeutung‘ zu sprechen und nicht von ‚Sinn‘, da es um das Verstehen von Symbolen geht. Können wir also den hermeneutisch gemeinten Sinn und die symbolische Bedeutung ohne weiteres gleichsetzen?“[59]
Danners Antwort lautet: Nein! „Komplexe Verwandtschaftsbeziehungen können beschrieben werden, auch die Implikationen (Bedeutungen), die damit gegeben sind. Der existentielle Sinn ist damit aber noch nicht erschlossen. Fragt man also im Sinne eines hermeneutischen Interesses weiter, dann möchte man den Sinn verstehen, der dieser (als Beispiel herangezogenen) ‚Identifikation‘ von Sohn und seinem väterlichen Großvater (bei den kenianischen Kikuyu) zugrunde liegt. Es liegt ja nicht am Namen, dass der Sohn sein Großvater ist; sondern er bekommt dessen Namen, weil er dieser ist. Hier endet wohl ein europäisch orientiertes Verstehen und bleibt als Frage und Verstehen-Wollen offen.“[60] Und ergänzt wenig später: „Aufgrund seines semiotischen Kulturverständnisses geht es Geertz um das Erfassen von Symbolen und deren Bedeutungen.“ Dabei ist die „Vorstellung [der Einheimischen] die ‚Bedeutung‘ des Symbols“. Wir müssen davon ausgehen, dass es der dichten Beschreibung nicht um ein Sinn-Verstehen geht … Dichte Beschreibung und eine hermeneutische Fragestellung gehen mit derselben Situation unterschiedlich um; ihre Fragerichtung – oder ihr Erkenntnisinteresse – ist verschieden.“[61]
„Geertz versteht die dichte Beschreibung als einen Interpretationsvorgang. Er sieht dabei eine zweifache Aufgabe; zum einen sollen die Vorstellungsstrukturen der untersuchten Subjekte aufgedeckt werden; zum anderen soll ein analytisches Begriffssystem entwickelt werden, das das Typische jener Strukturen aufzeigt. Das macht das Wesentliche der Interpretation bei Geertz aus … Ganz anders geht Hermeneutik vor, nicht zuletzt auch interkulturelle Hermeneutik, die die fremden Aussagen und Handlungen verstehen will.“[62]
„Zwar haben“, so Danner weiter, „interkulturelle Hermeneutik und dichte Beschreibung fremde Kulturen zu ihrem Gegenstand. Ihr Erkenntnisinteresse aber ist verschieden. Die dichte Beschreibung fragt auf der Ebene von Bedeutungen nach Symbolen und Strukturen; sie will als Ergebnis nicht wie eine Hermeneutik den Sinn von Handlungen und Ereignissen verstehen.“[63] Und kommt zu dem Schluss: „Dichte Beschreibung hilft einem hermeneutischen Zugang darin, dass sie zum „mikroskopischen“ Vorgehen ermutigt, nämlich zum konkreten genauen Hinsehen. Dichte Beschreibung stellt der interkulturellen Hermeneutik durch die Strukturierung des kulturell Fremden einen Zugang zu ihrem Gegenstand bereit; dem darf sie allerdings nur mit Vorsicht folgen, da in die ethnologische Interpretation möglicherweise Begriffe und Konzepte eingehen, die vom kulturell Fremden eher ablenken als zu ihm hinführen. Allerdings werden durch die dichte Beschreibung Bedeutungsstrukturen geliefert, die zu einem erklärenden Verstehen beitragen können. Dichte Beschreibung nimmt einer interkulturellen Hermeneutik ihre Absicht, Sinn zu verstehen, nicht aus der Hand, da Geertz feststellt: ‚Die abendländische Vorstellung von der Person […] erweist sich […] im Kontext der anderen Weltkulturen als eine recht sonderbare Idee.‘ Wie also müssten kulturell fremde Personen verstanden werden?“[64]
Summa summarum bietet der Sammelband „Culture – A Life of Learning“ viel Stoff für erkenntnistheoretisch interessierte Leser. Und selbst die zahlreichen erwähnten Merkwürdigkeiten des einen oder anderen Textes bieten jede Menge Diskussionsstoff. Wenn es in der Einleitung heißt, „Andererseits erschließt die Methode der dichten Beschreibung einen Zugang zu besagtem Sinn, zu Ängsten, Sorgen, Befürchtungen und Bedürfnissen von Menschen fremder Herkunft“[65], was m. E. mit einem kräftigen Fragezeichen zu versehen wäre, wäre ich aus heutiger Perspektive neugierig, wie Geertz diesen Punkt Jahrzehnte nach „Interpreting Cultures“ gesehen hätte.
Bibliographische Angaben
Gmainer-Pranzl, Franz & Barbara Schellhammer, Culture – A Life of Learning, Clifford Geertz und aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen, Berlin 2020
Weiterführende Literatur
Geertz, Clifford, The interpretation of Cultures – Selected Essays, London 1973 (1993)
Supp, Eckhard, Australiens Aborigines – Ende der Traumzeit?, Bonn 1985
Supp, Eckhard, Fremder, quo vadis? – Erkenntnistheoretische Überlegungen zum kulturkonfrontativen Denken, www.enos-mag.de 2024
Supp, Eckhard, Von Sachen und Gedanken – Phänomenologisches für die Ethnologie, www.enos-mag.de 2025
Fußnoten
[1] Supp, Eckhard, Australiens Aborigines – Ende der Traumzeit?, Bonn 1985.
[2] Geertz, Clifford, The interpretation of Cultures – Selected Essays, London 1973 (1993).
[3] Geertz, Clifford, Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt am Main 2002.
[4] Supp, Eckhard, Fremder, quo vadis? – Erkenntnistheoretische Überlegungen zum kulturkonfrontativen Denken, www.enos-mag.de 2024.
[5] Supp, Eckhard, Von Sachen und Gedanken – Phänomenologisches für die Ethnologie, www.enos-mag.de 2025
[6] Wobei auch der Untertitel nicht ganz glücklich gewählt scheint, denn in der Mehrzahl der gesammelten Essays geht es ja nicht um „aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen“, sondern eher um theoretische oder theoriehistorische, interpretative „Herausforderungen“.
[7] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer, Culture – A Life of Learning, Clifford Geertz und aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen, Berlin 2020. Die Sammlung ist trotz des engllischen Titels in deutscher Sprache erschienen.
[8] Geertz, C., a. a. O., 87. Das scheint selbst einigen der Autoren des Sammelbands ähnlich gegangen zu sein. Vgl. den Beitrag von G. Saalmann.
[9] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer, a. a. O., 8 und 72.
[10] a. a. O., 141: „Bali in der Sicht deutscher Touristen“
[11] a. a. O., 144 etwa:„Im Bewerbungsgespräch mit einem Tauchlehrer, der bereits lange Zeit in Afrika und Asien gearbeitet hatte, bevor er sich bei mir bewarb, verlieh ich meiner Überzeugung Ausdruck, dass Gäste allesamt Rousseaus Mär vom edlen Wilden glaubten. Schmunzelnd gab er mir recht.“
[12] a. a. O., 87.
[13] a. a. O., 89.
[14] Geertz, C., a. a. O., 9f.: „The point for now is only that ethnography is thick description. What the ethnographer is in fact faced with—except when (as, of course, he must do) he is pursuing the more automatized routines of data collection—is a multiplicity of complex conceptual structures, many of them superimposed upon or knotted into one another, which are at once strange, irregular, and inexplicit, and which he must contrive somehow first to grasp and then to render“.
[15] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer, a. a. O.,
[16] a. a. O., 30.
[17] a. a. O., 89.
[18] Geertz, C., a. a. O., 12.
[19] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer, a. a. O., 90.
[20] Shweder charakterisiert Geertz explizit mit: „Da ist kein festgelegter Wesenskern in der menschlichen Natur, hätte er gesagt, kein Geist für alle Kulturen.“ (a. a. O., 29)
[21] a. a. O., 92.
[22] Für Shweder fügt Geertz ja den Fakten kein Wesen und keine Bedeutung hinzu, sondern er sammelt Bedeutungen, die er vorfindet: „Geertz’ approach is empirical and reflects neither moralising identity politics nor critical postmodernism. Rather, Geertz was a tireless collector and interpreter of interpretations …” (a. a. O., 17). vgl. auch „Der ganze Zweck des semiotischen Zugangs zu Kultur besteht darin, so beschrieb er sein Vorgehen, „uns zu helfen, einen Zugang zu der Vorstellungswelt der Subjekte unserer Forschung zu finden, damit wir, in einem erweiterten Sinn, ein Gespräch mit ihnen führen können …“ (a. a. O., 24). Die Vorstellungswelt der „Subjekte unsere Forschung“ kann man wohhl kaum mit vom Ethnologen abstraktifiziertem Wesen verwechseln.
[23] Geertz, C., a. a. O., 7.
[24] “The thing to ask about a burlesqued wink or a mock sheep raid is not what their ontological status is. It is the same as that of rocks on the one hand and dreams on the other—they are things of this world. The thing to ask is what their import is: what it is, ridicule or challenge, irony or anger, snobbery or pride, that, in their occurrence and through their agency, is getting said.” Geertz, C., a. a. O., 10.
[25] „But there is, in addition, a fourth characteristic of such description, at least as I practise ist: it is microscopic” (a. a. O., 21).
[26] vgl. Geertz, a. a. O., 9.
[27] a. a. O., 14: „In short, anthropological writings are themselves interpretations, and second and third order ones to boot. (By definition, only a ‚native’ makes first order ones, his culture.) They are, thus, fictions; fictions, in the sense that they are ‚something made‚‘ , ‚something fashioned’—the original meaning of fictiō—not that they are false, unfactual, or merely “as if” thought experiments.”
[28] vgl. Supp, E., 2025
[29] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer, a. a. O., 11
[30] Supp, E., 2025, 57.
[31] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer, a. a. O., 24 f.
[32] a. a. O., 22.
[33] a. a. O., 25.
[34] a. a. O., 28.
[35] a. a. O., 27: „Anstatt dessen sahen ihn die Universalisten in den Sozialwissenschaften fälschlicherweise als einen Skeptiker oder Relativisten …“
[36] vgl. z. B. Supp, E., 2024, 15 f. und Supp, E., Vom Wissen und vom Zweifel, www.enos-mag.de 2023.
[37] vgl. dazu Geertz, a. a.. O., 24 f.
[38] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer, a. a. O., 39.
[39] vgl. Dazu Geertz, a. a. O., 13: „We are not, or at least I am not, seeking either to become natives (a compromised word in any case) or to mimic them. Only romantics or spies would seem to find point in that. We are seeking, in the widened sense of the term in which it encompasses very much more than talk, to converse with them, a matter a great deal more difficult, and not only with strangers, than is commonly recognized.”
[40] a. a. O., 44 f.
[41] a. a. O., 60: „Der zweite, noch wichtigere Grund, warum im Deutschen eine Fehlrezeption gefördert wurde, liegt in der Übersetzung begründet.“
[42] a. a. O., 62.
[43] vgl. Supp, E., 1985.
[44] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer,, 64.
[45] a. a. O., 101 f.: „„Es geht also um die Fragen, wie und ob fremde Kulturen verstanden werden können und was dichte Beschreibung und interkulturelle Hermeneutik zu diesem Verstehen beitragen.“
[46] a. a. O.
[47] a. a. O., 107.
[48] a. a. O., 11: „Die gründliche Reflexion seiner Felderfahrung und die Abkehr von positivistischen Forschungsmethoden zu Gunsten eines hermeneutisch-phänomenologischen Programms entspringen wohl seiner Nähe zur Philosophie und Literaturwissenschaft, die sich Geertz vornehmlich in den ersten Jahren seiner akademischen Karriere angeeignet hatte.“
[49] a. a. O., 40: „Kulturen als hermeneutische und ethische Orientierungsrahmen“.
[50] a. a.- O., 64: „Worin aber besteht die Methode der Interpretation, wenn das nicht die ‚dichte Beschreibung‘ ist? Es ist der hermeneutische Zirkel, der eigentlich eine ‚Spirale‘ ist. Durch das ‚beständige dialektische Lavieren zwischen kleinsten lokal spezifischen Details und umfassendsten Strukturen‘ erarbeitet man immer weiter reichende Interpretationen.“ und a. a. O. 66: „Diese pragmatistisch-hermeneutische Kulturtheorie kann mit anderen Bemühungen verbunden werden, eine Theorie der Praxis zu entwerfen.“
[51] a. a. O., 56: „Denn die Gründe, warum die Einheimischen einer ethnographischen Aussage zustimmen, sind auch im Rahmen einer mit Geertz als kulturhermeneutisch zu bezeichnenden Methodologie nicht aufzuklären …“.
[52] a. a. O., 156: „Für eine hermeneutische (d. h. in erster Linie verstehende) Kulturanthropologie – wie Clifford Geertz sie im Visier hat – stellen Konflikte eine besondere Herausforderung, aber auch einen besonders interessanten Untersuchungsgegenstand dar.“
[53] a. a. O., 103. Dazu auch der Titel des Dannerschen Essays: „Hilft die ‚dichte Beschreibung‘, fremde Kulturen zu verstehen? Eine hermeneutische Frage an Clifford Geertz“
[54] a. a. O., 106.
[55] a. a. O., 101.
[56] a. a. O., 116.
[57] a. a. O., 101.
[58] a. a. O.
[59] a. a. O., 117. Vgl. dazu auch Geertz, a. a. O., 10: „Doing ethnography is like trying to read (in the sense of “construct a reading of”) a manuscript—foreign, faded, full of ellipses, incoherencies, suspicious emendations, and tendentious commentaries, but written not in conventionalized graphs of sound but in transient examples of shaped behavior.”
[60] a. a. O. Eine äähnliche Frage hatte ich zum Ausgang meines Essays „Fremder, quo vadis? Gemacht, vgl. Supp, E., 2024.
[61] a. a. O., 118.
[62] a. a. O., 120.
[63] a. a. O., 122. Ganz nebenbei scheint Danner auch nicht viel davon zu halten, Geertz als Phänomenologen einzuordnen, was ich in meinem Essay „Von Sachen und gedanken“ diskutiert habe, vgl. Supp, E. 2025: „Seine ‚wissenschaftliche Kulturphänomenologie‘ lässt etwa die Konstitutionsanalyse der Bewusstseinserlebnisse der transzendentalen Phänomenologie Husserls hinter sich, um seine Leser auf einer Mikroebene in ein kulturelles Umfeld zu versetzen.“
[64] a. a. O., 123.
[65] Gmainer-Pranzl, F. & B. Schellhammer, a. a. O., 10.